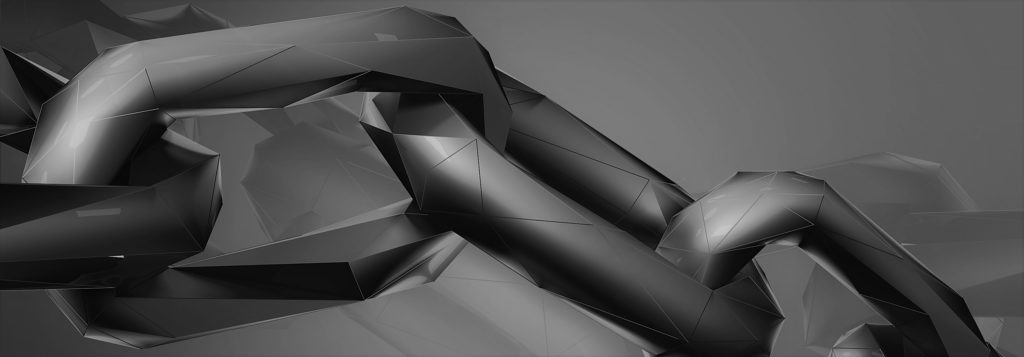Anfang Juni 2017 überraschte der amerikanische Präsident Donald Trump die weltweilte Staatengemeinschaft, die versucht den menschgemachten Klimawandel aufzuhalten, als er den Austritt der USA aus dem Übereinkommen von Paris bekannt gab.

Remember Paris?
Remember Paris?

Remember Paris?
21.08.2017
Anfang Juni 2017 überraschte der amerikanische Präsident Donald Trump die weltweilte Staatengemeinschaft, die versucht den menschgemachten Klimawandel aufzuhalten, als er den Austritt der USA aus dem Übereinkommen von Paris bekannt gab.
Warum war die Aufmerksamkeit so groß?
Zum einen, weil mit der USA einer der größten Emittenten von Treibhausgasen die Übereinkunft verlassen hat. Mit jährlichen 5 bis 6 Milliarden Tonnen CO2-Emission stehen die Vereinigten Staaten weltweit an zweiter Stelle im Ländervergleich. Es wurde befürchtet, dass mit dem Austritt der USA nicht mehr die notwendigen Emissionsreduktionen erreicht werden können, um das angestrebte Ziel von einem maximalen Temperaturanstieg von 1,5°C zu sichern.
Zum anderen handelt es sich beim Übereinkommen von Paris um ein historisches und beispielloses Abkommen zum Schutz der Umwelt. Das erste Mal waren sich 195 Länder der Welt einig den Klimawandel zu bremsen. Mit dem Ausstieg der USA setzte Präsident Trump einen Präzedenzfall, von dem befürchtet wurde, dass ihm andere folgen.
Überraschenderweise hat nicht nur kein weiterer Vertragspartner Anstalten gemacht, dem Beispiel der USA zu folgen, sondern verschiedene amerikanische Bundesstaaten und Kommunen (z.B. Kalifornien, New York,…) haben sich auch, unabhängig von der US-amerikanischen Bundespolitik, zu klimaschützenden Maßnahmen bekannt.
Was können wir aus dieser Erfahrung lernen?
Einerseits zeigt der amerikanische Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommens, dass die restliche Staatengemeinschaft geschlossen hinter Klimaschutzmaßnahmen steht und sich davon nicht beeindrucken lässt. Ganz im Gegenteil, es bildeten sich viele kleine Initiativen mit dem Ziel das Klima zu schützen. Kommunen rund um die Welt beleuchteten ihre Wahrzeichen und Rathäuser in grün (siehe Titelbild) und signalisierten so ihre Unterstützung zum Pariser Klimaabkommen.
Andererseits wird uns bewusst, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen, dass andere die notwendigen CO2-Verringerungen setzen. Vielmehr sollten wir mehr innovative Lösungen zur Emission-Reduktionen fördern. Wir können die Chance nutzen und mit wirtschaftlich erfolgreichem Beispiel vorangehen und uns einen Innovationsvorsprung sichern.
QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR:
The Paris Agreement – 2017 (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Kalifornien schließt Klimavertrag mi China. Pariser Klimaschutzakommen – 2017 (Zeit online)
Kalifornien und China unterzeichnen Klimaschutzabkommen 2017 (APA – energynewsmagazine.at)
US-Staaten und -Kommunen wollen Klima-Aktivitäten verstärken – 2017 (APA – energynewsmagazine.at)
Warum es auch ohne Amerika weitergeht. Klimaabkommen – 2017 (Decker, H. – faz.net)